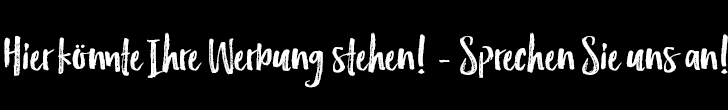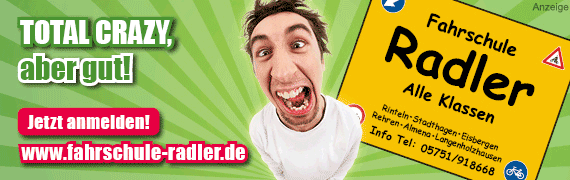Ein Blick hinter die Kulissen der Bierbraukunst – und das am Tag des Bieres. Im Rahmen von „Erlebnis Unternehmen“, der Aktion des Stadtmarketingvereins Pro Rinteln, ließ sich eine Besuchergruppe von „Waldkater“-Direktor Thomas Rathkolb in die Geheimnisse und Geschichte des beliebten Getränks einweihen.
Das Bierbrauen ist eine jahrhundertealte Tradition, doch so, wie es einst vor Einführung des Reinheitsgebots hergestellt wurde, würde es heute kaum jemand trinken wollen. Die Hefe war noch nicht erfunden, das Brauwasser kam aus den Flüssen und war trotz entsprechender Hinweise, sein Geschäft am Brautag doch bitte nicht im Wasser zu verrichten, nicht sonderlich sauber. Trotzdem galt Bier als Alternative zu Wasser, da es durch die Fermentation und den Alkoholgehalt relativ sauber war. Ausserdem diente es als nahrhafter Start in den Tag. Mit Spucke statt Hefe setzte man übrigens seinerzeit den Gärprozess in Gang, klärte Rathkolb die Teilnehmer auf.

Brauen konnte man nur in den Monaten Oktober bis März, da es sonst zu warm war. Entsprechend verarbeitete man alles, was man irgendwie in die Finger bekam, zu Bier. Auch den Weizen, der daraufhin wiederum zur Mehlherstellung fehlte. Also musste im Jahr 1516 das Reinheitsgebot her. Es regelte die Zutaten genau und stellte sicher, dass nicht wertvolles Brotgetreide im Bier landete. Inzwischen ist das Biergesetz deutlich reformiert worden, gab Rathkolb bekannt. 1992 entschloss man sich, über 25 Zusatzstoffe freizugeben, die nicht im fertigen Bier deklariert werden müssen – sofern sie nach dem Brauprozess wieder entzogen werden. Ein großer Gefallen für riesige Brauereikonzerne. Aufklärung gab es auch über die Bedeutung des mysteriösen Felsquellwassers, von dem in der Werbung oft die Rede ist. Das Brauwasser kommt in der Regel aus der Wasserleitung und wird aufbereitet. Ein Fingerhut voll Quellwasser zugesetzt – und schon sei die vollmundige Behauptung rechtens, war zu erfahren. Ohnehin seien die Mengen, die Handwerksbrauereien wie Hartinger produzieren, nicht mit den „Großen“ vergleichbar. Die Kapazität von rund 650.000 Liter Bier im Jahr, das im Waldkater mit eigenem Brunnen hinter dem Haus (ausschließlich zur Bierherstellung genutzt) entsteht, erreichen Großkonzerne in wenigen Tagen. Dabei ist das trendige „Craft-Beer“ in Rinteln längst nichts Neues. Seit über 29 Jahren braut man hier handwerklich hergestellte Biersorten in kleiner Auflage und ohne Tricks der „Großen“ Konzerne. Craft-Beer eben, nur klingt der englische Begriff gleich viel hochwertiger, weshalb sich immer mehr solcher Sorten auch im Angebot der Bierkonzerne befinden.
Je nach Malzröstung und Hopfensorte bekommt das Bier übrigens seine spezielle Note. Die Hefe spielt ebenfalls eine große Rolle und wird bedarfsweise eingekauft. Nach dem Brauprozess, den der Braumeister in Personalunion durchführt, kommt das Hartinger-Jungbier für sechs Wochen zum Reifen in große Behälter. Dann wird es in die bekannten Zwei-Liter-Gebinde abgefüllt und im Umkreis von 30 bis 40 Kilometern verkauft. Den Postversand, gibt Rathkolb schmunzelnd bekannt, habe man versucht, aber wieder eingestellt: Die Pakete seien unterwegs immer kaputt gegangen, allerdings habe man auch nie die Scherben zurück erhalten. Zum Abschluss gab es für alle Teilnehmer nach erfolgter Einweihung in die Geheimnisse der Braukunst als Erinnerung ein „Bierdiplom“.